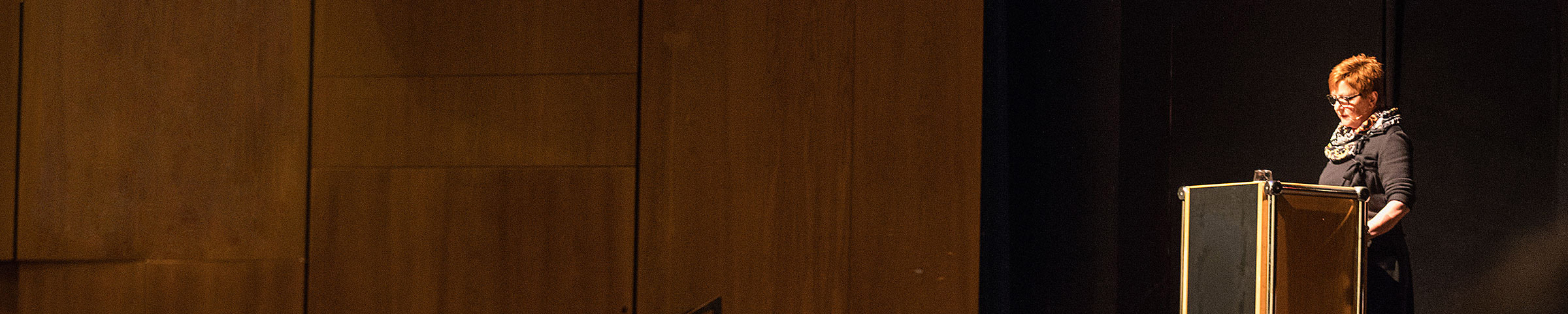
Migration und Schule
Von der Assimilation zur Pädagogik der Vielfalt – ein langer Weg
Als ich in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in Sempach die Schule besuchte, gab es dort kein einziges ausländisches Kind. Die «Fremden», das waren damals die wenigen Reformierten in einer mehrheitlich katholischen Gemeinde. Seither hat sich viel getan. Zu Beginn dieses Jahrhunderts ist es zur Normalität geworden, dass ein Fünftel aller Lernenden einen ausländischen Pass besitzt. Wie das Bildungswesen mit diesem Wandel umgegangen ist und welche Perspektiven für die Zukunft bestehen ist der Inhalt des folgenden Textes.
Assimilation und Ausländerpädagogik hiessen die Prinzipien der 60er und 70er Jahre
In den 60er Jahren kamen die ersten italienischen Kinder im Familiennachzug in die Schweiz. Die Schule reagierte nach dem Motto, die neuzugezogenen Kinder möglichst rasch an die schweizerischen Verhältnisse anzupassen. Das möglichst schnelle Erlernen der neuen Sprache und das möglichst rasche Vergessen des Hergebrachten war angesagt. Dieser assimilatorische Ansatz fand in der «Ausländerpädagogik» ihren Niederschlag. Diese ging davon aus, dass Lernende fremder Herkunft Defizite mitbrächten und durch sonderpädagogische Massnahmen möglichst schnell auf das Niveau der Einheimischen gebracht werden sollten.
Ein Paradigmawechsel in den 80er Jahren: Integration und Interkulturelle Erziehung
Erst in den 80er Jahren fand ein pädagogischer Paradigmawechsel statt, weg von der Assimilation und dem Defizitansatz hin zur Integration. Erstmals tauchte der Name «Interkulturelle Erziehung» in der pädagogischen Literatur auf. Fortan lief die Diskussion über die schulische Integration von zugewanderten Kindern unter diesem Titel. Auch in den mehrmals revidierten und bis heute gültigen Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) zur Schulung der fremdsprachigen Kinder fand dieser Wandel seinen Niederschlag. In der Version vom 24. Oktober 1991 steht:
«Die EDK bekräftigt den Grundsatz, alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die öffentlichen Schulen zu integrieren. Jede Diskriminierung ist zu vermeiden. Die Integration respektiert das Recht des Kindes, Sprache und Kultur des Herkunftslandes zu pflegen. Den Kantonen wird empfohlen bei der Erarbeitung von Lehrmitteln, Lehrplänen und Stundentafeln die Bedürfnisse der fremdsprachigen Kinder und die Anliegen einer interkulturellen Erziehung aller Schülerinnen und Schüler miteinzubeziehen, die Universitäten und andere Bildungsinstitutionen einzuladen, sich mit der Thematik der interkulturellen Erziehung zu befassen und interkulturelle Kontakte und Unterrichtsformen auf allen Stufen zu fördern und zu unterstützen.»
Verschiedenste Definitionen und Erklärungen über den Begriff «Interkulturelle Erziehung» sind seither im Umlauf. Zu Beginn standen jene Definitionen im Vordergrund , welche die Philosophie des Voneinanderlernens, der gegenseitigen kulturellen Bereicherung und Wertschätzung betonten. Kritische Stimmen meinten, dass diesen Definitionen etwas Beschönigendes, etwas Kitschiges anhafte, etwas, was den gesellschaftlichen Realitäten keineswegs entspreche. Denn für Zugewanderte gäbe es viel Ausgrenzung und Diskriminierung und handfeste Benachteiligung im Zugang zu fast allen relevanten gesellschaftlichen Einrichtungen, zu anspruchsvollen Tätigkeiten und Bildungseinrichtungen, zu politischer Mitsprache, usw.
Die deutsche Erziehungswissenschafterin Gabriele Pommerin brachte die Schwierigkeiten mit dem Begriff fogendermassen auf den Punkt: «Aufgrund des Dilemmas, keine klare, eindeutige und von allen akzeptierte Definition Interkulturellen Lernens vorlegen zu können, umschreiben wir Sozial- und ErziehungswissenschafterInnen Interkulturelle Erziehung als ‹pädagogischen Suchbegriff› für eine nicht-nationalistische oder antirassistische Pädagogik in einer mehrsprachigen und multhi-ethnischen Wirklichkeit.»
Die Forderung nach Zweisprachigem Unterricht
Seit belegt ist, dass die Vernachlässigung der Erstsprache einen bedeutenden Anteil am Schulmisserfolg von Migrantenkindern hat, ertönt im Zusammenhang mit der Diskussion über die interkulturelle Erziehung immer wieder der Ruf nach bilingualen oder mehrsprachigen Bildungskonzepten. Dazu der deutsche Linguist und Publizist Dieter E. Zimmer: «Widerlegt ist bis heute nicht die zwanzig Jahre alte Interdependenzhypothese des Kanadiers Jim Cummings: dass sich die Zweitsprache nur auf der Grundlage einer intakten Erstsprache entwickeln kann und dass dann auch die Erstsprache von der Zweitsprache profitiert. Sie bedeutet: wer, aus welchen Gründen auch immer, im richtigen Entwicklungsstadium nicht zu einer intakten Erstsprache gekommen ist, läuft Gefahr, im Semilingualismus stecken zu bleiben.»
Das bestärkt nebst vielen anderen auch die schweizerische Erziehungswissenschafterin Cristina Allemann-Ghionda: «Wird die Herkunftssprache und -Kultur eines Kindes in der Schule vernachIässigt oder gar gezielt unterdrückt und eine rasche und intensive Assimilation angestrebt, so sind persönliche Identitätsstörungen und psychosoziale Probleme häufig. Der Schulerfolg scheint stark davon beeinflusst zu sein, dass die Schule die Zweisprachigkeit der Kinder zuwenig zur Kenntnis nimmt, geschweige denn fördert. Empirische Studien weisen jedoch nach, dass eine Förderung der Zweisprachigkeit die allgemeine kommunikative Fähigkeit erhöht und das Lesen- und Schreibenlernen erleichtert. Mehrsprachigkeit ist zunehmend eine Schlüsselqualifikation. Den Schulen fällt daher die Aufgabe zu, diese Qualifikationen besser und umfassender zu vermitteln. Das kann dadurch erleichtert werden, dass die in den Klassen vorhandene Zwei-oder Mehrsprachigkeit gefördert wird.»
Auch die Expertengruppe, welche das Gesamtsprachenkonzept der EDK vom Juli 1998 erarbeitete, kam aus dem selben Grunde zur Forderung: «Die Kantone respektieren und fördern die in ihrer Schulbevölkerung vorhandenen Sprachen und integrieren sie in die Stundentafeln/Lehrpläne.» Bei der Vernehmlassung bei den Kantonen fiel dann diese Forderung leider unter den Tisch, weil die Kantone die finanziellen Folgen dieser Forderung fürchteten. Wenn eine wissenschaftlich unbestrittene Erkenntnis von solcher Tragweite aus finanzpolitischen Überlegungen nicht umgesetzt wird, trägt das Schweizer Schulsystem damit zu einem wesentlichen Teil zum Schulmisserfolg der Immigrantenkinder bei.
Politische Forderungen nach Segregation
Nicht nur was die mangelnde Förderung der Erstsprachen anbelangt, sondern generell ist festzustellen, dass der Paradigmawechsel hin zur Interkulturellen Erziehung nur sehr bedingt stattgefunden hat. Anders sein, fremd sein, wird häufig auch von Lehrpersonen immer noch als Problem definiert. Die Lernenden werden nach dem groben Raster ausländisch-schweizerisch, respektive fremdsprachig-deutschsprachige in zwei Kategorien eingeteilt. Politiker reden von Ausländerquoten, die nicht überschritten werden dürften. Es gab sogar eine ganze Reihe politischer Vorstösse in Kantonen und Gemeinden der deutschen Schweiz, die auf Dauer getrennte Klassen für die beiden Gruppen verlangten.
Dieses Denken reduziert Kinder auf ihren nationalen Status, auf die Zugehörigkeit zu einer Ethnie, zu einer fremden Sprache, wie wenn die Palette der Begabungen der Kinder nicht viel bunter, vielfältiger wäre. Es gibt Klassenbeste ausländischer Herkunft genauso wie weniger Begabte aus Schweizer Familien. Das Einteilen der Kinder in nur zwei Gruppen allein auf Grund des Kriteriums deutschsprachig-fremdsprachig steht im Widerspruch zur Idee der Einzigartigkeit eines jeden Menschen mit seinen je unterschiedlichen sozialen, sprachlichen und kulturellen Prägungen.
Wer sich der Integration als Modell des Umgangs mit den Eingewanderten verpflichtet, darf die Option der Segregation gar nicht in die Palette möglicher Problemlösungen aufnehmen, sondern muss alles andere versuchen: kleinere Klassenbestände, Klassenhilfen, Veränderung des Einzugsgebietes eines Schulhauses, Einrichtung von Schulsozialarbeitsstellen, Intensivierung der Elternarbeit unter Einbezug von MediatorInnen. Glücklicherweise haben sich die Schulfachleute bisher unisono gegen auf Dauer getrennte Klassen ausgesprochen. Auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR hat sich in ihrem Dossier «Getrennte Klassen» unmissverständich dagegen ausgesprochen: «Die dauerhaft getrennte Klasse für ausländische Kinder ist eine Diskriminierung, da allein aus der nationalen oder ethnischen Herkunft eines Kindes eine Minderbegabung abgeleitet wird. Eine solche auf Dauer angelegte institutionelle und strukturelle Ausgrenzung würde konsequent weitergeführt in ein Apartheid-System münden, welches zum Ziel hat, eine gleichberechtigte Teilnahme aller an der Gesellschaft zu unterbinden.»
Alarmierende Entwicklung bei den Kleinklassen
Eine Segregation findet aber schleichend dadurch statt, dass überdurchschnittlich viel Immigrantenkinder in Kleinklassen eingewiesen werden. Trotz interkultureller Absichterklärungen und trotz der vielen getroffenen Zusatzmassnahmen für Immigrantenkinder, ist es bisher nicht gelungen, den Trend der überdurchschnittlich häufigen Einweisung in Kleinklassen und Schulen mit geringen Ansprüchen zu brechen. Im Gegenteil! Die Tendenz ist steigend, jedes zweite Kind in Kleinklassen besitzt heute einen ausländischen Pass. Auch die neueste Nationalfond-Studie «Immigrantenkinder und schulische Selektion» von Winfried Kronig kommt zu erschreckenden Befunden: während die Zahl der Schweizerkinder in Sonderklassen in den letzten 20 Jahren um ein Fünftel zurückgegangen ist, sitzen dort heute dreimal mehr Immigrantenkinder. Und das nicht einfach wegen der gestiegenen Einwanderung, Sprachproblemen, kultureller Differenz oder individueller Schwächen, sondern weil die Lehrpersonen Immigrantenkinder bei gleicher Leistung und Intelligenz wie Schweizer Kinder generell tiefer einschätzen. Die Studie tritt auch dem Vorurteil entgegen, wonach die Entwicklung der Schweizer Kinder durch die Präsenz der Immigrantenkinder gebremst werde.
Diese Entwicklung ist alarmierend und die Schule darf sich nicht mehr mit den klassischen Erklärungsversuchen wie Unterschichtzugehörigkeit, Fremdsprachigkeit und Bildungsferne der Migrantenfamilien zufrieden geben. Markus Truniger, der Leiter der Fachstelle für Interkulturelle Pädagogik des Kantons Zürich sagt dazu: «Die Schule selbst ist ein Teil des Problems. Zu untersuchen ist, wieweit Konzepte, Programme und Praxis der Schule der real existierenden heterogenen Schülerschaft angemessen sind. Die bisherigen Konzepte umfassen vor allem die Unterstützung von Neuimmigranten und den Zusatzunterricht in der lokalen Sprache. Offenbar genügen aber diese Konzepte nicht, um den Lernerfolg entscheidend zu verbessern. Einen ebenso geringen Einfluss scheint ein punktuelles und oberflächliches interkulturelles Lerne – Zuckerguss über eine sonst monokulturell gebliebene Schule – zu haben.»
Die Lehre daraus ist, dass auch das gut gemeinte Konzept der Interkulturellen Pädagogik ohne kritisches Hinterfragen und Weiterentwickeln nicht zukunftstauglich ist. Wenn mit diesem Konzept Migrantenkinder auf ihre kulturelle und sprachliche Herkunft reduziert werden, satt sie mit ihren je eigenen Lebensgeschichten zu verstehen, muss es dringend revidiert werden. Denn zu diesen Lebensgeschichten können traumatische Flucht- und Migrationserfahrung, soziale Ausgrenzung und Diskriminierung gehören, aber auch Mehrsprachigkeit, Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit, Neubeginn und Aufbruch. Ohne diese Perspektive werden Migrantenkinder nur zu Trägern eines bestimmten kulturellen Clichés gemacht und alle Unterschiede, die zwischen Kindern bestehen, mit der anderen Kultur erklärt. «Typisch türkisch» greift zu kurz. Wenn dann dabei noch von der Unveränderbarkeit kultureller Normen ausgegangen wird, ist der Weg vom Begriff Kultur zum Begriff Rasse nicht mehr weit.
Blick nach vorn: Pädagogik der Vielfalt
Die Erkenntnis über die Schwierigkeiten und Tücken des Begriffs «Interkulturelle Pädagogik» führt unweigerlich zur Suche nach einer Alternative. Zur Zeit steht die «Pädagogik der Vielfalt» zur Diskussion. Durch die Globalisierung der Wirtschaft und durch die Mobilität der Menschen wird die Schule der Zukunft zwangsläufig in einem noch höheren Masse als heute eine Schule der Vielfalt sein. Kinder aus unterschiedlichsten Familienformen und sozialen Schichten, Kinder mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen und Begabungen, Kinder mit unterschiedlichsten weltanschaulichen und religiösen Prägungen und Kinder unterschiedlichster kultureller und sprachlicher Herkunft werden die Schülerschaft von morgen sein. Diese Heterogenität positiv zu nutzen und dabei die Qualität des Unterrichts und die Chancengleichheit für alle zu garantieren, das wird die ganz grosse Herausforderung des Bildungswesens sein. Für dieses ambitiöse Vorhaben könnte der Begriff der «Pädagogik der Vielfalt» durchaus dienlich sein. In der Romandie wird dafür auch der Begriff «Mehrperspektivischer Unterricht» verwendet.
Das Konzept der Pädagogik der Vielfalt umfasst alle die Unterschiede, die Kinder ausmachen: das Geschlecht, die soziale und kulturelle Herkunft, die Begabungen und Behinderungen, die Sprache(n), die Familienform, die Religion, usw. Kinder werden als Individuen mit all diesen unterschiedlichen Prägungen als einzigartig und unverwechselbar wahrgenommen. Die fremde Herkunft ist dabei eine Facette dieser Vielfalt.
Konsequenzen für die Lehrerbildung
Angehende Lehrpersonen müssen auf die Herausforderung dieser Heterogenität vorbereitet werden. Dafür nötige Kompetenzen sind vertiefte Kenntnisse der eigenen Gesellschaft mit all ihrer soziokulturellen Vielfalt wie auch Kenntnisse der Herkunftsgesellschaften der Migrantenfamilien. Dazu gehören Kenntnisse über Migration und Flucht und über die Migrations- und Asylpolitk der Schweiz wie auch über den Stand der Menschenrechtsdebatte. Im weiteren gehören die Auseinandersetzung mit den Begriffen Kultur, Integration, Identität, Universalismus, Mobilität und Globalisierung dazu. Wichtig ist auch die Analyse der Entstehung von Rassismus, Antisemitismus und Fundamentalismus. Es muss auch über die Bedeutung des gesellschaftlichen Diskurses über die sogenannte Ausländerfrage nachgedacht und die eigene Haltung all diesen Fragen gegenüber geklärt werden.
Dem letztgenannten Punkt kommt beim Erlernen mehrperspektivischer Kompetenzen eine entscheidende Rolle zu: ohne das Reflektieren der eigenen Verortung in einer pluralistischen Welt, dem eigenen Weg und der eigenen Prägungen dahin ist es schwierig, die Unterschiedlichkeit der Kinder nicht als Störfaktor, sondern als Bereicherung oder wenigstens als Normalität zu begreifen. Wer die eigene Sicht der Welt als Norm und als allein gültige versteht, hat Mühe, andere Perspektiven zu akzeptieren. Selbstverständlich entbindet das nicht von einer Diskussion darüber, welche gemeinsamen Werte, welcher Konsens für das Zusammenleben in Schule und Gesellschaft notwendig sind. Im Gegenteil, gerade die Vielfalt erfordert es, den Vorrat an Gemeinsamkeiten sorgfältig zu bewahren.
Ganz aktuell: Rassismus und Rechtsextremismus als neue Herausforderung
Aufgeschreckt durch die Ereignisse auf dem Rütli sind sich viele Leute bewusst geworden, dass rechtsextremes, rassistisches Gedankengut für einen Teil der Jugendlichen wieder attraktiv geworden ist. Das muss auch das Bildungswesen beschäftigen, denn die Verachtung und Geringschätzung von Personen anderer Hautfarbe, anderer ethnischer Herkunft und Sprache sowie von Angehörigen der jüdischen und der islamischen Religion tangiert einen Grundwert unseres Bildungswesens. Damit ist das Menschenbild angesprochen, das der Schule zu Grunde liegt. Die Antwort darauf lässt sich durch die Auseinandersetzung mit der universalen Menschenrechtsidee finden, welche ihren Ursprung in der Aufklärung hat. Diese sagt, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind, dass alle Menschen das Recht auf soziale Sicherheit, Arbeit, Erholung, Wohlfahrt, Bildung und Teilnahme am kulturellen Leben haben, und dass niemand aufgrund der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion diskriminiert werden darf.
In der Erklärung der EDK zu Rassismus und Schule lässt sich die gleiche Grundhaltung feststellen: «Die Schule hat zur Achtung vor den Mitmenschen, zur Toleranz unter religiösen, ethnischen, sozialen u.a. Gruppen und zum Frieden unter den Völkern zu erziehen. Unterricht und Erziehung in der Schule wirken darauf hin, dass offene und versteckte Formen von Rassismus bewusst gemacht und bekämpft werden und dass die Begegnung mit fremden Menschen angstfrei und offen verlaufen kann.»
Was so einfach tönt, ist nicht einfach umzusetzen. Aber ein Bildungswesen, das diesen Werten verpflichtet ist, kann beim Aufkommen rechtsextremer und rassistischer Gewalt nicht tatenlos zuschauen, es kann aber auch nicht mit spektakulären Aktionen das Problem aus der Welt schaffen. Erziehung zu Toleranz und gegen Gewalt und Rassismus ist ein Dauerauftrag der Schule. Die Pädagogik der Vielfalt weist dafür einen gangbaren Weg.
Mit einem Satz des Erziehungswissenschafters Anton Strittmatter möchte ich schliessen: «Wer von Kindsbeinen an gewohnt ist, die Dinge von verschiedenen Seiten her zu betrachten, nach Hintergründen zu fragen, Vertrautes mal im Kopfstand anzuschauen, Überraschendes und widersprüchliches nicht gleich zu bereinigen, genauer hinzusehen und hinzuhören, der wird weniger anfällig sein für Ängste vor Fremdem und für Einfachlösungen in Form bündiger Clichés und Vorurteile.»
Weiterführende Literatur
- «Getrennte Klassen?»
Ein Dossier zu den politischen Forderungen nach Segregation fremdsprachigen Kinder in der Schule
Eidgenössische Kommission gegen Rasssismus, 1999 - «Immigrantenkinder und schulische Selektion»
Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren
Winfried Kronig, Urs Haeberlin, Michael Eckhart
Verlag Paul Haupt, 2000 - Gute Schulen im multikulturellen Umfeld
Peter Rüesch
Bildungsdirektion des Kantons Zürich
Verlag Orell Füssli, 1999 - «Odyssea»
Ansätze einer interkulturellen Pädagogik
Christiane Perregaux, Claudio Nodari
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1998 - «Vom Störfall zum Normalfall»
Kulturelle Vielfalt in der Schule
P.E.Ochsner, U.Kenny, P. Sieber
Chur/Zürich: Verlag Rüegger, 2000